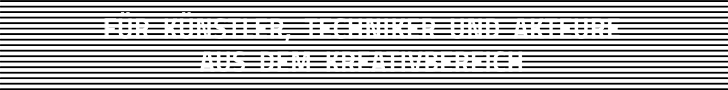Chor der Soulformation J`Traine / © Archiv Engelmann Fotografie
Eigentlich wollte ich diesen Artikel erst nicht veröffentlichen. Es geht doch teilweise sehr ins „Eingemachte“. Einen Chor möglichst authentisch aufzunehmen ist komplex und erfordert einen fundierten physikalisch-tontechnischen Background, den ich hier beleuchten will.
Ich gehe jedoch davon aus, dass ihr nicht nur Rockies seid, die diesen Beitrag lesen. Den Stage-Tontechnikern empfehle ich im Besonderen den nachfolgenden Zusatzteil 2/2 über die Live-Abnahme von Chören, denn da habe ich noch den ein oder anderen wertvollen Praxistipp.
Hinweis: Am Ende des Beitrags findet ihr Produkt-Tipps zu den besten Mikrofonen + Zubehör für die Abnahme von Chören.
Ein Erfahrungsbericht
Je nach Größe des Chores benutze ich zwischen 2 und 5 Mikrofone, die direkt vor und über dem Chor stehen. Zusammen bilden sie ein Hauptmikrofonsystem (sog. „Multi- Stereofonie“). Ergänzend dazu – sozusagen für die „Totale“ – noch eine Stereomikrofonanordnung mit 2 Mikrofonen.
Stereohauptmikrofon
Diese Anordnung wird häufig als Haupt-Stützmikrofontechnik bezeichnet. Ich möchte diesen Terminus aber bewusst vermeiden, denn diese Art Mikrofonierung, bei der ein Stereohauptmikrofon (bestehend aus 2 Mikrofonen oder einem Koinzidenzmikrofon (= Mikrofon mit 2 Kapseln in einem Gehäuse) mit Zusatzmikrofonen gestützt wird.
Es liefert jedoch nur dann befriedigende Ergebnisse, wenn der Chorklang in sich schon sehr ausgewogen ist.
Einfangen des Ambientes
Das Stereomikrofon für die Totale ist mehr zum Einfangen des Ambientes gedacht und nicht als „Hauptmikrofon“ im schulmäßigen Sinne zu verstehen.
Hast du es mit einem kleineren Chor zu tun – so etwa bis zu 20 Sänger – so genügt meist eine 2-Mikrofonanordnung in ORTF-Aufstellung * (2 Nierenmikrofone im gegenseitigen Abstand von 17 cm und einem Spreizungswinkel von 110°). Den Abstand zum Chor musst du ausprobieren – je nach Halligkeit des Raumes zwischen 2-5 Meter.
Eine andere Variante ist die Verwendung eines in XY oder MS-Anordnung ** aufgestellten Stereokoinzidenzmikrofons (an Stelle der ORTF). Grundsätzlich solltest du nur Kondensatormikrofone benutzen, da sie die präziseste und verfärbungsärmste Übertragung ermöglichen. Denn gerade bei Chormusik sind Klangverfärbungen äußerst störend.

Richtcharakteristik
Für die einzelnen vor und über dem Chor angeordneten Mikrofone solltest du Nierenmikrofone benutzen. Es können aber auch Kugeln sein, wenn die Mikrofone nicht zu dicht beieinander stehen. Kugeln haben auf jeden Fall eine bessere Baßübertragung. Lies dazu auch unseren Beitrag von Jürgen Schwörer (Shure): „Mikrofongrundlagen: Richtcharakteristik“.
Wenn du den Chor blockweise aufstellst, also S-A-T-B ***, kann vor jede Stimme ein Mikrofon gestellt, und dann die Signale mit den Panoramareglern des Mischpultes auf die Stereobasis verteilt werden.
Dabei ist zu beachten, daß die abgebildete Richtung der Stimmen mit der des Stereomikrofons zusammenfällt, sonst gibt es im Stereoklangbild Mehrfachabbildungen die sehr unschön wirken.
Kontrolle mit Kopfhörer
Am besten kontrollierst du das mit Kopfhörer. Zuerst das Signal des Stereomikrofons anhören, und dann langsam die übrigen hinzumischen. Verschiebt sich dabei die durch das jeweilige Einzelmikrofon eingefangene Teilschallquelle im Stereoklangbild, musst du mit dem Pan-Regler solange justieren bis die Richtungen übereinstimmen – mehrmals probieren!
Doch die oben genannte Aufstellung S-A-T-B bilde ich sehr ungern. Denn im Stereoklangbild stehen da die tieferen Stimmen rechts und die hohen Stimmen links.
Genau das erzeugt aufgrund der Hörphysiologie den Eindruck, als sei trotz gleichem Pegel der linke Kanal lauter als der rechte. Besser ist eine klassische Choraufstellung mit S-A vorne und T-B dahinter. Dann ist die hoch/tief-Verteilung homogener.
Große Chöre
Bei der Aufnahme von großen Chören (20 bis 100 Sänger) benutze ich bis zu 5-6 Mikrofone, und zwar: 3 vor den Chor und 2-3 über dem Chor auf die hinteren Stimmen gerichtet, also so eine „M“- förmige Anordnung, sowie ein Stereomikrofon für die Totale wie oben beschrieben. Hierbei hat sich übrigens eine ganz andere Aufstellung des Chores bewährt: Sopran links, Alt rechts und dreieckig angeordnet in der Mitte die Männerstimmen.

Ein Gospelchor: Schlecht gemacht: 3 Mikros vor dem Chor und dann baumeln noch 3 über ihm / © Iyinoluwa John Onaeko für Unsplash
Die Bässe
Entweder die linke Hälfte des Dreiecks mit den Tenören und die rechte mit den Bässen oder der Tenor vorne und der Baß hinten. Dann ist die „M“-Anordnung erst recht vorteilhaft. Denn die Bässe brauchen immer Mikrofone für sich, weil die Sopran- und Altstimmen hörphysiologisch bedingt (siehe oben) immer lauter erscheinen.
Auch ist bei vielen Chören der Umstand zu beobachten, daß i.d.R. mehr Frauen- als Männerstimmen vorhanden sind.
Noch etwas zu den Mikrofonen:
Als Stereomikrofonanordnung für die Totale kann du auch 2 Kugelmikrofone verwenden. Kugelmikrofone haben, wie bereits erwähnt, eine bessere Bassübertragung (physikalisch bedingt) und geben auch die räumliche Tiefenstaffelung richtig wieder.
Bei Verwendung von Koinzidenzmikrofonen in XY-Aufstellung (2 Nieren, Supernieren oder Achtcharakteristiken = „Blumleinanordnung“) passieren oft Fehler. Du darfst dich nicht dazu verleiten lassen, die Achsen der maximalen Empfindlichkeit auf die Ecken der Schallquelle auszurichten. Das habe ich leider schon oft bei Anfängern beobachten müssen!
Gerade bei 2 um 90° gespreizten Nieren führt dies zu einem sehr schwach ausgeprägten Stereoeffekt. Nicht der Winkel der Achsen maximaler Empfindlichkeit bestimmt die Basisbreite der Abbildung, sondern die der minimalen Empfindlichkeit. Und die ist bei der besagten Einstellung nicht 90° sondern 270°!
Nur dann, wenn der Chor in einem 3/4-Kreis um das Stereomikrofon mit 90° Achsenwinkel und 2 Nieren steht, wird die Basisbreite voll genutzt.
Ein Winkel von 180 bis 200° reicht
Allerdings ist in der Praxis kein Winkel von 270° erforderlich. Denn es genügt eine Kanaltrennung zwischen L und R von 18 dB, um eine Schallquelle vollständig links bzw. rechts zu orten (nach den Kurven von Williams). Ein Winkel von 180 bis 200° um das Mikrofon herum reicht aus.
Mal ganz davon abgesehen, dass es auch für den Dirigenten schwierig wäre, wenn die Sänger einen Winkel von 270° bilden würden.
Kondensatormikrofone mit auswechselbaren Kapseln
Weiterhin solltest du noch beachten, dass einem Stereokoinzidenzmikrofon – aber auch mehr oder weniger die ORTF-Anordnung -immer polar orientiert ist. Soll heißen: wird die Schallquelle geradlinig vor das Mikrofon aufgestellt, sind die mittleren Stimmen immer etwas lauter als die äußeren.
Wer öfter Choraufnahmen macht und nicht vor größeren Geldausgaben zurückschreckt, sollte sich Kondensatormikrofone mit auswechselbaren Kapseln besorgen. Noch bequemer sind solche mit umschaltbaren Richtcharakteristiken.
Richtungsbestimmung von Hörereignissen
Eine weitere mittlerweile gemachte Erfahrung möchte ich dem experimentierfreudigen Tontechniker nicht vorenthalten: Jeder der sich einmal mit der Materie des „Richtungshörens“ näher auseinandergesetzt hat, weiß, dass die Richtungsbestimmung eines Hörereignisses nicht nur von Pegelunterschieden zwischen linkem und rechtem Ohr erfolgt. Es sind auch die Laufzeitdifferenzen zwischen links und rechts.
Und letztendlich erfolgt eine Richtungsbestimmung durch Klangfarbenunterschiede.
Letzteres soll hier nicht näher betrachtet werden, wohl aber die Erzeugung der Richtungsinformation mit Laufzeitunterschieden. Bei den heutigen modernen Digitalmischpulten findet man häufig die Möglichkeit, jeden Kanal individuell zu verzögern.
Die erreichbaren Laufzeiten liegen zwischen 1 Sample bis zu 50 Millisekunden. Es liegt nun nahe, Choraufnahmen (da diese ja relativ wenig Mikrofone erfordern) in reiner Laufzeitstereofonie zu machen.
Für jedes Mikro zwei Kanäle
Dazu musst du zunächst jedes Mikrofon auf 2 Mischpulteingänge verteilen. Jedes Mikrofon belegt somit 2 Kanäle. Diese müssen auf gleiche Verstärkung eingestellt werden. Die Kanalpegelsteller sollten dann gekuppelt werden, entweder mechanisch, oder elektronisch wenn das Mischpult dies ermöglicht.
Sodann werden für jedes Mikrofon die Pan-Pots der beiden belegten Kanäle auf die Eckstellungen gebracht.
Anstatt mit den Pan-Pots die Richtungen festzulegen, werden nun die einzelnen Delays in den Kanälen unterschiedlich eingestellt. Soll die Schallquelle außerhalb der Mitte erscheinen, muss der Kanal früher kommen auf dessen Seite die Schallquelle abgebildet werden soll.
Ich überlasse es dir hier selbst, damit einfach mal zu experimentieren. Meiner Erfahrung nach werden musikalisch geschulte Hörer beim Umschaltvergleich zwischen herkömmlicher Panpot-Technik und Laufzeitstereofonie , die letztere als „besser“ empfinden.
Techniken zur Mikrofonierung von Chören kombinieren
Wenn du es ganz perfekt machen willst, kannst du beide Techniken kombinieren. Gegebenenfalls stellst du noch Klangfarbenunterschiede zw. L und R (die beim natürlichen Hören ja auch entstehen) in dem jeweiligen Kanalpaar ein.
Beim Einstellen der Delays empfiehlt es sich unbedingt, die Mischung zwischendurch auch mal in Mono abzuhören. Denn durch ungünstig eingestellte Laufzeiten entstehen unangenehm klingende Kammfilterwirkungen ****. Diese fallen dann bei der Addition der Kanäle zu Mono sofort auf.
Da die Mikrofone auf jeweils 2 Kanäle wirken, solltest Du Dich vorher überzeugen ob die Belastung des Mikrofons durch den Eingangswiderstand des Mikrofonverstärkers noch zulässig ist.
Lesetipp:
Die „Mikrofonaufsätze“ von Jörg Wuttke (https://www.ingwu.de/mikrofontechnik/mikrofonaufsaetze.html).
Channel Cloning
Je nach Struktur des Digitalmischpultes kann es aber auch sein, dass eine Aufsplittung auf 2 Kanäle nicht notwendig wird, nämlich dann, wenn die für die Verzögerung notwendige Delaystrecke funktionsmäßig „hinter“ dem Pan-Pot liegt.
Du stellst dann bei allen Kanälen das Pan-Pot auf die Mittelstellung. Nur die Delays hinter dem Pan-Pot stellst du auf unterschiedliche Zeiten ein. Die Alternative heißt „Channel Cloning“, Du verteilst nach dem Preamp ein Signal per digitalem Routing auf zwei Kanalzüge.
Der Aufnahmeraum
Der Aufnahmeraum stellt auch ein wichtiges Kriterium dar. Grundsätzlich gilt: Überall da, wo man sich beim Singen wohlfühlt und angenehm hört, sind meist auch Aufnahmen in mindestens passabler Qualität möglich. Das kann eine Kirche oder ein Vereinsheim sein. Hauptsache, es tritt nicht zu viel Fremdschall (Autos etc.) auf.
Achte vor allen Dingen auf tieffrequenten Störschall (Heizung etc.)! Den hörst Du hinterher recht deutlich auf jeder Aufnahme.
Toll, wenn Du bis hier durchgehalten hast. Dann wird auch der 2. Teil dieses Beitrags interessant für Dich sein, denn hier erfährst Du, wie Du eine Livebeschallung mit einem Chor feedbacksicher und mit authentischem Klang realisierst, und das auch in größeren Hallen.
Welche speziellen Erfahrungen habt ihr bei der Chorabnahme? Schreib uns doch dazu was in die Kommentare. Und jetzt zum zweiten Teil der Mikrofonierung und Übertragung von Chören!

Glossar
- * ORTF-Aufstellung
- = Als ORTF-Stereosystem bezeichnet man eine Anordnung von zwei Mikrofonen für die Tonaufnahme in Äquivalenzstereofonie bzw. gemischte Stereofonie zur Lautsprecherstereofonie
- .
- ** XY oder MS-Anordnung
- = eine Stereoaufnahmetechnik mit zwei um 90° gekreuzte Achtmikrofone. Es zeichnet sich durch eine besonders gute Raumwiedergabe und breite Stereobasis aus. Der Stereoeindruck entsteht durch Pegeldifferenzen (Intensitätsunterschiede) und nicht durch Laufzeitunterschiede der Kanäle (Blumlein-Stereosystem).
- .
- *** SATB
- = S-A-T-B (seltener SCTB) ist eine häufig verwendete Abkürzung für die übliche Besetzung eines vierstimmigen Gesangsensembles (Chor oder Solisten) mit den Stimmlagen Sopran (Soprano), Alt (Contralto), Tenor (Tenore) und Bass (Basso).
- .
- **** Kammfilterwirkungen
- = Ein Kammfilter (englisch comb filter) ist ein Filter, das aus Signalen Gruppen bestimmter Frequenzen filtert. Im Unterschied zu Tief- und Hochpass ist es durch mehrere Filterfrequenzen im gleichen Frequenzabstand gekennzeichnet. Der Amplitudengang (Pegel über die Frequenz) des Frequenzgangs des Kammfilters hat ein kammartiges Aussehen, woher das Kammfilter seinen Namen hat.
Unsere Produktempfehlungen zum Thema
Hier gibt es eine kleine Auswahl an Mikrofonen für Chöre, die auch speziell für die Live Abnahme auf Bühnen geeignet sind.
Faustregel: je größer der Chor, desto mehr Mikrofone braucht man. Dabei geht man fast immer von der klassischen Mikrofonierung mit 2 Mikrofonen aus (OrtF, AB oder XY) und ergänzt diese dann sinnvoll mit weiteren Mikros in der Breite und Tiefe.
Superlux S502
Für kleine Chöre, die es sich leicht machen wollen und auf einem einzigen Stativ direkt ein Doppelmikro für den gesamten Chor haben möchten. Komplettset im Koffer mit Kabelsatz:
Rode NT-5 Matched Pair Mikrofon-Set
Top Mikrofone zu einem sehr guten Preis, mit dem wir auch selbst arbeiten, sind die Rode-NT5 Kleinmembranmikrofone. Ähnlich wie die 4 Mal so teuren Neumann Mikrofone haben sie eine hochwertige gleichmäßige Schallaufnahme, sind sehr pegelfest und auch bestens für akustische Instrumente geeignet. Sie sind einzeln erhältlich, oder auch, wie hier im abgestimmten Paar:
Rode NT45-0 Kleinmembran Wechselkapsel
Speziell für Aufnahmen gibt es als Wechselkapsel mit Kugelcharakteristik für die Rode-NT5, nämlich die Kapsel Rode NT45-0:
Neumann KM184 Stereo Set
Professionelle Neumann Technik, made in Germany: Abgestimmtes Pärchen der tausendfach bewährten Kleinmembraner KM184 mit sehr gleichmäßiger Übertragung für alle Schalleinfallsrichtungen. Auch bestens zur Instrumentalabnahme und im Studio geeignet:
Audix ADX 40 White
Für über dem Chor hängende Mikrofone (Theaterzüge etc.) gibt es spezielle Kleinstmikrofone, die über einen Fixierbare Drahtvorrichtung ausgerichtet werden können. Ein Beispiel vom amerikanischen Mikrofonexperten Audix, das es auch in schwarz gibt:
K&M 20800 Overhead Mikrofonstativ
In manchen Fällen ( Besonders bei kleinen Chören) und wenn man genau weiß, was man tut, lässt sich mit unsichtbaren, auf den Boden gelegten Grenzflächen ein sehr authentischer Sound erzielen.
Sehr gute Erfahrungen haben wir mit den halbcardoiden Grenzfläche Shure Beta 91A gemacht:
Stereoschienen
Um 2 Mikrofone optimal auf einem einigen Stativ auszurichten, empfiehlt sich eine sog. Stereoschiene. Damit können die Mikros gemäß ORTF, XY oder Klein-AB ausgerichtet werden:
Rode Stereo Bar SB20
Gravity MS STB 01 PRO
K&M 23550 Mikrofon-Ergänzungsschiene
Hier als einfache Stereo Ergänzungsschiene:
Mikrofonstative
Auch am Mikrofonstativ sollte man nicht sparen. Gute Bodenentkopplung und stabile, resonanzfreie Rohre sind die Basis für eine gute Übertragung.
K&M 210/9 Mikrofonstativ schwarz
Der Klassiker schlechthin von K&M, made in Germany:
K&M 20800 Overhead Mikrofonstativ
Für extreme Höhen bis über 3m, gibt es, auch mit Galgen erweiterbar, ebenfalls ein sehr brauchbares Stativ vom deutschen Hersteller K&M:
Wir geben unsere Tipps aus jahrelanger praktischer Erfahrung weiter. Als Händler empfehlen wir sehr gerne Thomann.de, hier habt ihr 30 Tage Rückgaberecht bei voller Geldrückgabe. Außerdem sind Beratung und Service Top.

Folge uns jetzt auf Instagram & Facebook und verpasse keine Artikel und spannende Infos mehr!
Außerdem interessant: Unsere Facebook-Gruppe StageAID-Talk!